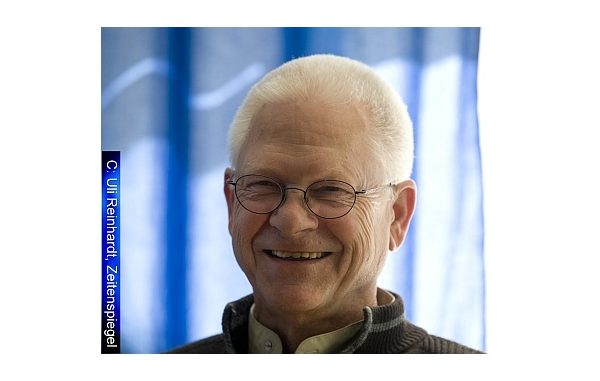
Vor knapp zwei Wochen bin ich aus Afghanistan zurückgekehrt und versuche zu sortieren, was ich erlebt habe: Bevor ich abreiste, wurde in Kabul erzählt, die Taliban seien in das Büro einer westlichen Hilfsorganisation eingedrungen. Dort hätten Mitarbeiterinnen bei der Arbeit gesessen. Die Taliban hatten aber ausländischen Hilfsorganisationen verboten, Mitarbeiterinnen zu beschäftigen. Sie hatten zwar Ausnahmen für medizinische und Unterrichtsprojekte gemacht. Aber in den Büros westlicher Organisationen durften sich keine Frauen aufhalten. Dagegen hatten die Damen verstoßen. Die Taliban gingen tätlich gegen sie vor. Die Frauen flüchteten.
Übrigens ist die Anwesenheit von Frauen in den Büros von afghanischen Hilfsorganisationen nicht verboten. In Krankenhäusern oder Banken arbeiten Frauen fast so normal wie vor dem Eintreffen der Taliban. Die starken Einschränkungen für Mitarbeiterinnen ausländischer Organisationen hatten die Taliban mit der „Frechheit“ dieser Frauen begründet. Die Mitarbeiterinnen ausländischer Organisationen hatten nämlich öffentlich gegen Bestimmungen protestiert, die die Bildungsmöglichkeiten und die Bewegungsfreiheit von Frauen massiv einschränken.
Die Mitarbeiterinnen westlicher Organisationen hatten sich für Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Recht auf Bildung; kurz für Menschenrechte eingesetzt und Zivilcourage gezeigt. „So muss es sein.“ werden sich die Unterstützer der entsprechenden Organisationen in den Heimatländern gesagt haben. Die ausländischen Leiter der Organisationen hatten gute Arbeit geleistet. Sie hatten ihren Mitarbeitern offenbar die richtige Einstellung zu den Werten vermittelt, um die es uns geht: Um die Menschenrechte, insbesondere um die Rechte der Frauen.
Man sollte dieses Heldentum nicht vorbehaltlos bejubeln. Wir Westler wollten den Afghanen eine Staatsform bescheren, in der die Menschenrechte in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eingebettet sind. Viele Afghanen lehnte das ab. Sie wollten nach den althergebrachten Regeln ihrer Vorfahren leben. Sie fürchteten auch, dass die ausländischen Werte, nicht mit den Geboten des Islam vereinbar seien. Der Widerstand gegen die westlichen Werte wurde von den Taliban getragen. Es kam zum Krieg. Den haben die Taliban gewonnen.
Wer jetzt Afghanistan betritt, muss sich an die von den Taliban installierte Ordnung halten. Für ihn gelten die Gesetze der Taliban. Er muss damit rechnen, dass er nach ihren Regeln bestraft wird, wenn er sich nicht an ihre Gesetze hält.
Die Leiter ausländischer Organisationen haben eine Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter. Sie hatten keine Mittel, die Frauen vor den unkalkulierbaren Strafen der Taliban zu schützen. Sie hätten die Frauen von ihren Protesten abhalten müssen.
Die Taliban hatten die Ausländer bekämpft und besiegt, weil sie nicht nach deren Wertvorstellungen leben wollten. Und jetzt wollten ihnen protestierende Frauen genau diese Werte schon wieder aufnötigen. Außerdem gingen die Taliban nicht ganz zu Unrecht davon aus, dass letztlich die Ausländer selber hinter den Protesten steckten und ihre Mitarbeiterinnen vorschoben.
Was taten die afghanischen Organisationen? Die wurden von den Taliban nicht wegen „Frechheit“ sanktioniert. Deren Mitarbeiterinnen sitzen unbehelligt mit ihren männlichen Kollegen in den Büros. Dabei haben viele afghanische Hilfsorganisationen keine anderen Ziele als westliche Organisationen. Aber an öffentlichen Protesten haben sie nicht teilgenommen. Sie kennen ihr Land. Sie wissen, welche Formen der Auseinandersetzung in Afghanistan zielführend sind und welche nicht.
In der Frage, ob man jungen Mädchen und Frauen eine schulische oder akademische Ausbildung erlauben soll, sind die Taliban gespalten. Der Emir Haibatullah hat sich festgelegt: Frauen und Mädchen dürfen Grundschulwissen erlernen – aber nicht mehr. Wichtige Minister wie der Verteidigungsminister und der Innenminister waren entsetzt. Sie führen Kampagnen durch, in denen sie der Bevölkerung erklären, wie wichtig Bildung für die Entwicklung des Landes ist. Ohne dass Frauen und Mädchen ausgebildet werden, wird man in einigen Jahren keine Ärztinnen und Lehrerinnen haben, die Frauen behandeln und Mädchen unterrichten können. Dennoch vermeiden es mächtige Minister, den Emir Haibatullah persönlich anzugreifen.
Um das besser zu verstehen, muss man bei der Erziehung beginnen, namentlich bei der, afghanischer Knaben, die innerhalb der Familie oder Großfamilie einmal Oberhaupt werden sollen. Denen geben die Frauen, in deren Händen die Erziehung von Kleinkindern liegt, die Prägung mit in ihr Leben, dass sie die Großartigsten auf der Welt sind. Man erfüllt ihnen alle Wünsche. Sie lernen kaum Grenzen ihres Handelns kennen. Die Führungskräfte in der Politik und im Staat waren in Kindheit und Jugend meist auch für die Führung familiärer Strukturen ausgewählt. In den „Ethnokrimis“ (Siehe unsere Homepage OFARIN.org!) finden Sie mehr darüber. Solchen Machos darf man nichts zumuten, wobei sie „ihr Gesicht verlieren“. Gegenteilige Ansichten müssen deshalb für längere Zeit ertragen werden, ohne dass man sie öffentlich herausstellt. So können beide Seiten ihr Gesicht wahren, während ihr Konflikt sich abkühlt. Mit etwas Glück, findet sich eine goldene Brücke, über die man der Gegenseite helfen kann. Wenn nicht, verliert der Konflikt mit der Zeit an Aktualität, und eine Seite kann sich stillschweigend zurückziehen.
Der Emir Haibatullah hat sich öffentlich gegen die Ausbildung von Frauen und Mädchen ausgesprochen. Er verhindert damit, dass Afghanistan schnell seine Bildungsmöglichkeiten entwickelt und wirtschaftlich den Anschluss an die übrige Welt findet. Vermutlich verstärkt der Emir mit seiner Stellungnahme sogar das Verlangen der Menschen nach Bildung noch. Andrerseits haben Hunderttausende von Taliban an einem Krieg teilgenommen, der sich gegen alles wandte, was seit einem Jahrhundert an Modernem auf Afghanistan eindringt. Der Kulturkampf – Schule gegen Moschee; Schlagwort: „Schule ist Sünde“ – gehörte zu dieser Auseinandersetzung mit der Moderne. Die Krieger der Taliban haben gegen Schulen gekämpft. Die meisten sind Analphabeten. Die anderen Afghanen, die in die Schule gingen, während sie sich mit ihren Kalaschnikows auf Überfälle vorbereiteten, haben jetzt bessere Perspektiven – ja, auch die Mädchen. Vermutlich brauchen diese Krieger noch Zeit, um sich von ihren Feindbildern zu verabschieden. Man kann sagen, dass der Emir einer der wenigen Taliban-Führer ist, der die Kämpfer mit ihren überholten Kriegszielen nicht alleine lässt. Die Position des Emirs und der Kämpfer wird nicht lange haltbar sein. Die Bevölkerung und die meisten Taliban-Führer haben längst verstanden, dass Afghanistan Schulen und Bildung braucht.
Schon hat man Brücken vorbereitet, über die sich der Emir ins Lager der Befürworter von Schule und Bildung schleichen könnte: Man sei ja nicht prinzipiell gegen die Ausbildung von Mädchen. Man müsse nur erst die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Jugend nach den Prinzipien der Geschlechtertrennung ausgebildet werden kann. Dazu brauche man mehr Lehrerinnen und Dozentinnen und Räumlichkeiten. Außerdem müssen für die jungen Mädchen Kleider entworfen werden, die die Männer nicht beunruhigen können. Wenn man das alles vorbereitet habe, sollen auch wieder Mädchen und Frauen ausgebildet werden.
Vermutlich wird man nicht so lange warten wollen. Nach weiteren Monaten wird man sich nicht mehr genau daran erinnern, was die Kontrahenten in dieser Sache gesagt haben. Dann wird man ohne öffentliche Rede zum Unterricht an Schulen und Universitäten zurückkehren, wie er vor der Taliban-Herrschaft üblich war. Wenn jetzt aber ein namhafter Vertreter der einen oder der anderen Seite laut den Fortschritt oder den Rückschritt verlangte und seinen Gegnern gar persönliche Vorwürfe machte, wäre die Auseinandersetzung wieder aktualisiert und jeder Fortschritt wäre für viele Monate verhindert.
Jetzt ist der Streit um die Ausbildung von Frauen und jungen Mädchen das Hauptthema in der öffentlichen Auseinandersetzung. Er muss noch weiter abklingen, bevor man die Vernunft obwalten lässt. Deswegen ist meine Gewissheit, dass Frauen und Mädchen „bald“ wieder lernen dürfen, für ein fünfzehnjähriges Mädchen, das einmal Abitur machen will, oder für eine zwanzigjährige Frau, die Lehrerin werden will, ein zynischer Trost. Wenn die in einigen Jahren dann doch noch lernen dürfen, sind sie Ehefrauen und Mütter.
Was macht OFARIN in dieser Situation? Ich habe mich schon dazu bekannt, dass wir Ausländer uns in Afghanistan an die Gebote der Taliban zu halten haben. Aber, lässt man sich so nicht vereinnahmen? Die Taliban können damit werben, dass westliche Organisationen wie OFARIN sie als Partner respektieren. Damit festigt OFARIN deren Herrschaft. Die Alternative wäre, nicht nach Afghanistan zu gehen. Dann wäre man moralisch auf der sicheren Seite – auf den ersten Blick zumindest.
Wir halten es für sinnvoll, unabhängig von der Staatsform und von den sonstigen Gesetzen eines Landes eine gute elementare Schulbildung für die Bevölkerung anzubieten, solange das möglich ist. In Afghanistan ist das möglich, auch wenn es durch die von den Taliban gewünschte Geschlechtertrennung und durch die Einschränkungen des Einsatzes unserer Trainerinnen etwas behindert wird. Also tun wir es.
Nur durch unsere Anwesenheit und unsere Arbeit können wir herausfinden, wie eng die Behörden, mit denen wir kooperieren, die offiziellen Bestimmungen auslegen und wo wir im Einverständnis mit afghanischen Beamten, die offiziellen Einschränkungen unseres Tuns nicht so genau nehmen müssen, ohne unsere Mitarbeiter zu gefährden.
Die Herrschaft der alten Taliban über den größten Teil des Landes von 1996 bis 2001 war eine finstere Zeit. Jede Musik war verboten. Taliban-Krieger durchsuchten Fahrzeuge nach Musikkassetten, zerstörten diese, wenn sie welche fanden, und verprügelten die Passagiere. Frauen brauchten keine feinen Kleider, weil keine Feste stattfanden. Bilder und Fotos waren verboten, nur Passbilder für amtliche Zwecke waren erlaubt. Niemand investierte. Es gab keine Bautätigkeit. Mehltau lag auf der Wirtschaft und auf allen Bereichen des Lebens. Dann konnte unsere damalige Organisation in augenzwinkernder Übereinstimmung mit einigen einflussreichen Taliban den Unterricht anbieten, der zu unserem heutigen Programm wurde. Wir konnten in hoffnungsloser Zeit etwas beginnen, was Hoffnung ausstrahlte.
Ist die jetzige Zeit schlimmer als damals, so dass man lieber nichts wagen sollte? Musik ist wieder verboten. Aber in den zahlreichen Hochzeitspalästen der Stadt Kabul werden ganz selbstverständlich ruinös teure Hochzeiten gefeiert. Die Damen tragen aufwändige Kleider. Es gibt feine Mahlzeiten. Nur Musik ist – wie damals – verboten. Allerdings fahren durch alle Gassen kleine Wagen, die Speiseeis anbieten und – je nach der Firma zu der sie gehören – ein paar Takte aus „für Elise“ oder „Happy birthday to you“ dudeln. Die Bautätigkeit schreitet voran. Straßenbauprojekte, die das „demokratische“ Regime begonnen hat, werden weitergeführt. Wer das finanziert – ich weiß es nicht. Lehrer werden weiterhin von der internationalen Gemeinschaft über UN-Agenturen bezahlt. Möglicherweise kommen weitere solcher Mittel ins Land, vielleicht auch aus arabischen Ländern. Das Finanzministerium hat sich neu organisiert. Es zieht von Firmen und Organisationen korrekt Steuern ein.
Die Sicherheitslage war seit Jahrzehnten nicht so gut wie jetzt. In den ersten Monaten der Taliban-Herrschaft gab es noch brutale Anschläge von Kämpfern des „Islamischen Staats“ auf Unterrichtsveranstaltungen der schiitischen Minderheit. Das hat aufgehört.
Wir waren auch im letzten Herbst in Afghanistan und hatten davon berichtet, dass Menschen, die die Taliban nicht durchweg ablehnten, dem neuen Regime keine Chance gaben. „Die schaffen es einfach nicht, eine ordentliche Regierung zu bilden.“ hörten wir damals von verschiedenen Beobachtern. In diesem Frühjahr haben wir diese Einschätzung nicht mehr gehört.
Angehörige von Minderheiten, etwa vom Volk der Hazara, erinnerten sich mit Schaudern an die Herrschaft der „alten Taliban“. Als die „neuen Taliban“ an die Macht kamen und sie nicht wieder so drangsalierten wie die „Alten“, erklärten sie stereotyp: „Die halten sich noch zurück. Aber wenn die mal fest an der Macht sind, wollen sie alles so machen, wie früher.“ Jetzt kommen sie nicht damit zurecht, dass es nicht wieder so schlimm wurde, wie früher. „Ja, die sind nicht so brutal wie früher. Aber was wollen sie eigentlich?“
Ein Afghane, der ausländischen Journalisten zuarbeitet, und moderne Ansichten kennt und teilt, aber beruflich mit führenden Taliban zu tun hat, sagt, er sei beeindruckt, wie sehr sich die Mitglieder des afghanischen Kabinetts einsetzten und ernsthaft daran arbeiteten, das Land voran zu bringen. Dabei muss allerdings ergänzt werden, dass nicht alle Taliban, die der Umschwung in Führungspositionen spülte, ihren Aufgaben gewachsen sind.
Die Taliban haben viele Soldaten der „demokratischen“ Regierung in ihre Streitkräfte integriert, sogar einige Generäle. Leider kann man daraus keine Regel ableiten. Nachbarn, die miteinander Streit haben, denunzieren ihr Gegenüber mit irgendwelchen Beschuldigungen, z.B. mit der, dass die Tochter bei Ausländern gearbeitet hat „Sie wissen ja, was da alles passiert.“ So etwas kann böse Folgen für die Beschuldigten haben.
Unser Büro-Manager ist Hazara und Schiit. Der zuständige Abteilungsleiter unseres ehemaligen Partnerministeriums war ein junger Mann mit wenigen Schreibkenntnissen, aber vollgestopft mit allen Vorurteilen eines strammen Sunniten. Also verdächtigte er unseren Büro-Manager, ein iranischer Spion zu sein, denn die Iraner sind ja auch Schiiten. „Wenn der verhaftet wird, können wir ihm nicht helfen.“ warnten mich meine Kollegen im letzten Herbst. Wir beurlaubten unseren Büro-Manager und rieten ihm, sich in der Provinz aufzuhalten. Zu Weihnachten erschienen dann Polizisten mit einem Haftbefehl. Die Kollegen halfen dem Mann und seiner Familie sofort unter zu tauchen.
Ein anderer Kollege, Nagib, hatte bei uns als Fahrer gearbeitet. Er gehörte zum Clan des letzten „demokratischen“ Staatschefs Aschraf Ghani. Die Familie von Aschraf Ghani bat ihn, bei ihr als Fahrer, namentlich der Ehefrau des Präsidenten zu arbeiten. Nagib folgte diesem Wunsch. Er verdiente sicher auch besser als bei uns. Als Aschraf Ghani vertrieben wurde, wurde Nagib arbeitslos. Wir stellten ihn wieder ein. Wir sind jetzt mit ihm als Fahrer nach Khost gereist. Auf dieser Strecke passierten wir weit über dreißig Kontrollen. Man wird gefragt, woher man kommt und wohin man fährt. Wenn die Kontrolleure noch den Ausländer entdecken, der da mitfährt, muss der sich ausweisen. Das geschieht höflich und korrekt. Dann kann man weiterreisen. Niemand verschwendet einen Gedanken auf Nagib. Ist der wegen seiner früheren Beschäftigung nicht gefährdet? Nein, er ist es nicht.
Aber das Beispiel unseres Büro-Managers zeigt, dass niemand dafür garantieren kann, dass alle Afghanen vor den Taliban in Sicherheit leben.
Auch sollte man nicht verschweigen, dass das gewaltige Drogenproblem des Landes von den Taliban mit einem Furor bekämpft wird, der Angst macht. Bisherige Regierungen hatten das Drogenproblem ignoriert. In der Stadt Kabul gab es bestimmte Gegenden, in der Drogenkranke in wachsenden Kolonien dahinvegetierten. Es gab private Initiativen, die sich rührend um diese Menschen kümmerten. Bisherige Regierungen taten nichts. Anders die Taliban. Sie schufen riesige Heilstätten, in denen die Kranken entgiftet werden. Einen großen Teil dieser Anstalten finanziert die Getränkefirma Alokozai. Doch mehr als die Entgiftung können die Taliban den Süchtigen nicht bieten. Die sind nämlich nach der Entgiftung noch süchtig und extrem rückfallgefährdet. Werden sie tatsächlich rückfällig, werden sie von den Taliban erschossen. So reduzieren die Talban das Drogenproblem entschlossen und brutal.
Dieses Verfahren durch ein menschlicheres zu ersetzen, übersteigt die Möglichkeiten der Taliban. Hier kann allenfalls internationale Unterstützung helfen. Doch westliche Hilfe wird nur über UN-Organisationen gewährt. Das ist besonders teuer. Für spezielle Aufgaben engagierten sich besser einzelne Länder. Warum springt Deutschland nicht ein – oder andere europäische Länder oder die Europäische Union? Mit den Taliban arbeiten westliche Länder nicht zusammen. Die lehnen die Menschenrechte ab. Aber das tut Kambodscha auch und viele afrikanische Länder, ohne dass man denen Entwicklungshilfe verweigert. Deutschland hat ja nicht einmal diplomatische Beziehungen zu Afghanistan. Warum nicht? Die USA haben auch keine diplomatischen Beziehungen. Und das ist des Pudels Kern.
Die USA sind 2001 von Islamisten im eigenen Land angegriffen worden. Die Führung dieser Islamisten lebte in Afghanistan und wurde von den Taliban geschützt. Die UN-Vollversammlung stimmte dem Wunsch der USA zu, sich militärisch zu wehren. Wir anderen haben brav Waffenhilfe geleistet und uns am zivilen Aufbau und militärischen Schutz eines demokratischen afghanischen Staates beteiligt. Die USA haben dann dieses Engagement abgebrochen, ohne ihre Verbündeten oder den afghanischen Staat zu konsultieren. Wir haben uns brav mit den USA aus Afghanistan zurückgezogen. Jetzt gibt es keinen Grund, der Taliban-Regierung die diplomatischen Beziehungen zu verweigern, außer dem, dass die USA solche Beziehungen auch nicht aufgenommen haben.
Dabei ist es kein Nachteil für die USA, wenn Verbündete in Afghanistan damit vorangehen, mit dem jetzigen Taliban-Staat normale Beziehungen herzustellen. Zu diesem Staat gibt es keine Alternative. Die Regierung ist von der Bevölkerung akzeptiert. Eine Bewegung, die die Taliban vertreiben könnte, gibt es nicht. Eine solche Bewegung könnte höchstens von einem Nachbarland aufgebaut und ausgerüstet werden, was für Afghanistan Bürgerkrieg bedeutete. Es liegt im Interesse aller, dass Afghanistan ein stabiles Land in dieser unruhigen Region der Welt wird. Das jetzige Afghanistan hat das Zeug dazu.
Sicher, es gibt dort noch die Frage nach der Ausbildung von Frauen und Mädchen; und auch das schauerliche talibanische Verfahren, das Drogenproblem zu lösen. Aber gerade auf diese Fragen können wohlwollende potente Länder einen großen Einfluss ausüben. Man könnte Afghanistan dabei helfen, rückfällige Drogenkranke medizinisch zu behandeln, auch wenn die Erfolgschancen, wie überall auf der Welt, gering sind. Der Widerstand gegen die Ausbildung von Frauen und Mädchen verschwände vermutlich, wenn man allen Kriegern der Taliban eine Grundausbildung in den Kulturtechniken des Schreibens, Lesens und Rechnens ermöglichte.
Man sollte aber überlegen, welche Entwicklungshilfe man in Afghanistan leisten will. Im Schulbereich haben die GiZ und die großen Organisationen der anderen Länder während der „demokratischen Periode“ etliche Milliarden Euros und Dollars verprasst und nichts erreicht. Das Schul- und Bildungswesen des Landes ist unvorstellbar schlecht. Die paternalistisch denkenden und bürokratisch handelnden Apparate der internationalen Entwicklungshilfe, die letztlich auch keine Kontrolle über die Mittel haben, die sie verwalten, haben bei der Entwicklungszusammenarbeit im Schulwesen vollkommen versagt.
Als wir von Khost nach Kabul zurückreisten, überholten wir immer wieder Lastwagen, die bis oben mit Kartoffeln beladen waren. Meine Kollegen erklärten mir, dass das afghanische Kartoffeln seien. Die seien in Afghanistan gewachsen. Afghanistan habe aber keine Kühlhäuser. So habe man die Ernte billig nach Pakistan verkauft, wo sie den Winter in Kühlhäusern zubrachte. Im Frühjahr kaufe man sie dann teuer zurück. Vermutlich hatte die internationale Gemeinschaft Afghanistan Mittel für Kühlhäuser zur Verfügung gestellt. Die verschwanden dann aber in der Korruption. So besitzt Afghanistan keine eigenen Kühlhäuser – nicht nur nicht für Kartoffeln. Es ist sicher möglich, die Schaffung von Kühlhäusern so zu organisieren, dass sie tatsächlich gebaut werden. Es gibt sicher noch vieles, was man gemeinsam anpacken könnte. Aber man müsste über die Art und Weise der Kooperation etwas mehr nachdenken und den Mut haben, nicht auf den großen Bruder zu warten.
Zum Schluss ist es meine traurige Pflicht, mitzuteilen, dass unser Mitglied Sigune Dankwort gestorben ist. Sigune war erst vor zwei Jahren zu OFARIN gestoßen. Wir hatten uns aber schon sehr lange gekannt und eine wunderschöne Paddeltour auf der Drau gemacht. Sigune hatte in jungen Jahren Afghanistan bereist.
Herzliche Grüße
Peter Schwittek.
