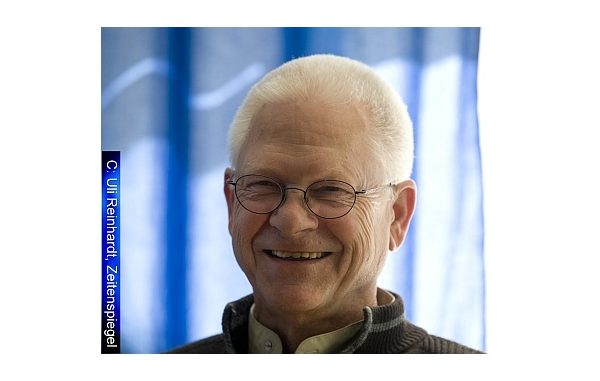
Jetzt sind wir wieder zu Hause und haben Muße, uns die Lage in Afghanistan durch den Kopf gehen zu lassen. Das lässt sich nicht in wenigen Zeilen erledigen. Mein Sohn Jürgen rät mir dringend, nicht zu lange Rundbriefe zu schreiben. Nun gut, er liest wie viele seiner Generation vorwiegend Comics. Aber vielleicht hat er trotzdem Recht. Daher werde ich das, was ich zu Lage sagen will, aufteilen und Ihnen in wöchentlichen Portionen zumuten.
Warum hat es mit der Demokratie nicht geklappt?
Im Jahr 2001, dem Jahr der Vertreibung der Taliban, beschloss die Weltgemeinschaft, in Afghanistan einen demokratischen Staat aufzubauen.
Afghanistan hatte seit 1978 nur Fremdherrschaft, Bürgerkrieg und Zerstörung gesehen. Die Staatsverwaltung hatte sich traditionell als obrigkeitlicher Besitzer des Staates empfunden. Dass sie eigentlich ein Dienstleister für die Bevölkerung hätte sein müssen, war ihr fremd. 2001, nach Krieg, Bürgerkrieg, der Herrschaft von Kommunisten und Taliban war sie brutal dezimiert und kaum noch arbeitsfähig.
Wie macht man unter solchen Umständen ein Land zu einer Demokratie? Man trifft sich in einem fernen Ort, z.B. in Bonn, und peilt über den Daumen, was der Staat Afghanistan in absehbarer Zukunft kostet, wenn er keine eigenen Mittel zu seiner Verwaltung und seinem Wiederaufbau aufbringen kann. Dann blickt man in die Runde und fragt, wer wieviel zu diesem Gesamtbetrag beisteuern kann. Für Afghanistan kam genug zusammen, auch wenn sich später nicht alle an ihre Versprechen hielten.
So denken Politiker. Sie brechen eine Aufgabe auf ihre Kosten runter. Der Entscheidungsträger fragt: „Was kostet das?“ Experten peilen über den Daumen und nennen eine Zahl. Der Politiker bespricht das im Kabinett vor allem mit dem Finanzminister. Schließlich wird der Betrag in etwa bewilligt. Der Entscheidungsträger und der Finanzminister klopfen sich öffentlich auf die Schultern. Ihre Aufgabe ist erledigt. Den Rest machen ihre Verwaltungen. In den Krisen, mit denen Deutschland gerade kämpft, zeigt sich, dass der Entscheidungsträger sich auch etwas mit den inhaltlichen Problemen der Aufgabe hätte beschäftigen sollen. Vor allem zeigt sich an allen Ecken und Enden, dass unsere Verwaltung nie so ausgestattet ist, um eine größere Aufgabe zu bewältigen, die plötzlich anliegt. Unsere Verwaltung hatte vor Corona gemütlich vor sich hin verwaltet und sich kaum Gedanken über Effizienz und Reformen gemacht.
Aber in Afghanistan standen 2002 nur die geschundenen Reste einer schlechten Verwaltung vor einem ruinierten Land. Und diese Verwaltung sollte alles neu aus dem Boden stampfen – Gesundheitswesen, Verkehrswesen, Justiz, Schulen, … und, und, und … ! Immerhin, Geld war da. Doch Geld allein baut kein Land wieder auf.
Als Krone sollte diese hoffnungslos überforderte afghanische Fachverwaltung einen demokratischen Überbau erhalten. Ein Zeitplan stand fest. Eine traditionelle Stammesversammlung bestimmte ein vorläufiges Staatsoberhaupt. Eine gewählte Versammlung arbeitete eine Verfassung aus, die per Abstimmung anerkannt wurde. Ein Staatsoberhaupt und ein Parlament wurden gewählt, ebenso wie Vertretungen der Provinzen.
Doch was verbinden Menschen, die nie in einer Demokratie gelebt haben, mit dem Begriff Demokratie? Für sie heißt Demokratie „Wahlen“. Und solche ersten Wahlen seit Generationen werden von den Menschen als einmalig empfunden. Hier wird entschieden, wer in Zukunft an der Macht ist. Dass bei der nächsten Wahl vieles geändert werden kann und dass Amtsperioden von Gewählten begrenzt sind, daran denkt bei einer ersten Wahl niemand. Auch denkt kaum jemand daran, dass die Gewählten nicht machen können, was sie wollen. Ihr Spielraum ist durch die Verfassung und die Gesetze begrenzt.
Dass das meist auch denen kaum bewusst ist, die die Wahl gewinnen, können wir gerade in unserer Nähe beobachten. Unsere ungarischen und polnischen Nachbarn hatten sich, nachdem sie sich von den Fesseln des Kommunismus befreit hatten, ganz selbstverständlich für die Demokratie entschieden. Was denn sonst?
Es wurde gewählt. Die Sieger bildeten die Regierung. Endlich konnten sie bestimmen. Einige Geschäftsleute hatten sich bei der Wahl sehr für Vertreter der neuen Regierung eingesetzt. Solchen Freunden möchte man jetzt bei der Erteilung geschäftlicher Aufträge großzügig entgegenkommen. Die Kommunisten hatten eine ethnische Minderheit gefördert. Deren politische Vertretung wird verboten und aufgelöst. In den Schulen und Universitäten muss die glorreiche Vergangenheit des Landes mehr betont werden. Kritische Untersuchungen über dunkle Zeiten der nationalen Vergangenheit werden untersagt.
Es gab noch mehr, wofür sich die neue Regierung einsetzten wollte. Aber vieles kommt nicht voran. Wenn der Staat geschäftliche Aufträge einfach vergibt, klagen Konkurrenten dagegen und die Richter geben ihnen Recht. Aufträge müssen öffentlich ausgeschrieben werden. Die ethnische Minderheit wurde von den Kommunisten begünstigt. Das stimmt. Aber ihr Recht auf eine eigene Vertretung darf man ihr nicht nehmen. Die Erforschung der eigenen Geschichte ist Aufgabe der Universitäten. Da darf sich der Staat nicht einmischen.
Viele Vorhaben der Regierung scheitern. Bürger klagen gegen neue Gesetze. Richter geben ihnen Recht. Ja, was sollen dann die Wahlen? Die Regierung ist „an der Macht“, hat aber nichts zu sagen. Die polnische Regierung ging davon aus, dass es an den Richtern liegen muss, und begann diese auszutauschen. Damit verstieß sie gegen einen wesentlichen Grundsatz, der in allen Rechtsstaaten gelten muss. Richter müssen bei der Anwendung des geltenden Rechts vollkommen unabhängig sein. Die polnische Regierung lernt unter Schmerzen, dass ihr Land ein Rechtsstaat sein muss, wenn er eine Demokratie sein will.
Dass sie das erst lernen muss, ist nachvollziehbar. Polen war jahrzehntelang kein Rechtsstaat gewesen. Die Machthaber hatten verfügt, wie Gerichte zu entscheiden haben.
Es fällt auf, dass funktionierende Demokratien sich fast immer aus Rechtsstaaten heraus entwickelt haben. Das Zusammenleben der Menschen war in Staaten, die später Demokratien wurden, meist schon für längere Zeit ausführlich durch Gesetze geregelt. Manche dieser Gesetze entsprechen heute nicht mehr unseren Vorstellungen. Aber damals trugen sie dazu bei, das Miteinander der Menschen zu ermöglichen. Dann räumte man den Bürgern gewisse Rechte der Mitbestimmung am staatlichen Geschehen ein. Schritt für Schritt wurden diese Rechte erweitert. Die Demokratie entstand.
Eine Demokratie ist ein Zusammenspiel von Parlament, Justiz und Regierung innerhalb eines Rechtsstaates. Dieses Zusammenspiel wird durch Gesetze geregelt. Das Parlament wird gewählt. Es kann einen Teil der Gesetze abändern, abschaffen und durch neue Gesetze ersetzen. Die Regierung regiert und verwaltet das Land nach den geltenden Gesetzen. Die Spitzen der Regierung werden in manchen Demokratien direkt vom Volk gewählt, in anderen Ländern vom Parlament.
Und in Afghanistan? Dort galten seit Urzeiten die Gesetze der Stammesgesellschaft – mit Blutrache, Blutgeld und Schlichtung durch lokale Honoratioren oder geistliche Würdenträger. Auch Mord und Totschlag wurden lokal geahndet. Der König Amanullah ließ ein Gesetzbuch nach italienischem Vorbild schaffen. Die Rechtspraxis änderte das kaum. Nur wenige Fälle, an denen prominente Personen beteiligt sind, werden nach dem Gesetzbuch behandelt.
Für den weitaus größten Teil des Landes ist bis jetzt die traditionelle lokale Rechtsausübung üblich. Hinzu kommt, dass es in der langen Zeit des Krieges und Bürgerkrieges sehr viele brutale Übergriffe jenseits jeder Rechtsprechung gab.
Afghanistan war also alles andere als ein Rechtsstaat alteuropäischen Zuschnitts, aus dem sich die westlichen Demokratien entwickelt hatten. Es ist nicht bewiesen, dass nur Staaten, die im 19ten und 20ten Jahrhundert Rechtsstaaten waren wie die Schweiz, Holland oder die britischen Kolonien in Amerika, sich zu Demokratien entwickeln können. Aber die rechtsstaatlichen Gegebenheiten Afghanistans waren unendlich weit davon entfernt, eine Demokratie tragen zu können.
Auch die afghanische Verwaltung mit ihrem eigenmächtigen Dünkel und ihrer dürftigen Qualität bot keine Voraussetzungen für eine Demokratie. Allein die Durchführung von Wahlen war stets umstritten. Es gab viele massive Fälschungen. Meist konnte kein gültiges Endergebnis veröffentlicht werden. Dann griffen die USA ein und vermittelten eine gemeinsame Leitung des Staates durch die führenden Kandidaten. Die Bürger konnten zwischen Präsidentschaftskandidaten wählen. Wen sie aber gewählt hatten, konnte nicht ermittelt werden.
Bei der Wahl des nationalen Parlaments und der Vertretungen der Provinzen durften keine Listen aufgestellt werden, also Parteien in unserem Sinn. Man fürchtete, die Listen könnten nach ethnischen Gesichtspunkten gebildet werden und so den Separatismus fördern. So konnte auch nicht zwischen politischen Richtungen gewählt werden. Entsprechende Parteien existierten ohnehin kaum. Formal bestanden Parlamente aus Einzelpersonen, die aus ihren Rechten Kapital schlugen. Jeder Minister, den der Staatspräsident vorschlug, musste vom Parlament bestätigt werden, bevor er ernannt werden konnte. Solche Kandidaturen ließen erhebliche Geldströme fließen.
Wenn man sich das alles durch den Kopf gehen lässt, sieht man, dass der Versuch, in Afghanistan eine Demokratie einzuführen, nie Aussicht auf Erfolg hatte. Man hätte viele Fehler vermeiden können. Aber auch dann hätten keine Voraussetzungen für die Einführung der Demokratie bestanden. Ich wünsche Afghanistan von Herzen eine Demokratie. Länder, die viel bessere Voraussetzungen haben, eine Demokratie auszubilden, haben große Probleme mit dieser Aufgabe. Wie soll Afghanistan eine Demokratie werden, wenn das Tunesien oder Serbien kaum schaffen?
Man darf den Afghanen nicht vorwerfen, sie hätten versagt. Der Plan, in Afghanistan eine Demokratie zu schaffen, kam nicht von ihnen sondern von der internationalen Gemeinschaft. Die müsste erklären, warum ihre Planungen nicht das gebracht haben, was man sich davon versprochen hatte.
Der Standardvorwurf: „Bei den Afghanen klappt einfach nichts. Wir haben ihnen wieder einmal eine Chance gegeben und sie haben sie nicht genutzt.“ liegt vollkommen daneben. Das war keine Chance. Das war von Anfang an ein Abenteuer, das schief gehen musste.
Ich habe viele Situationen erlebt, in denen Afghanen sich bewährt haben, in denen sie sich große Mühe gaben, in denen sie zuverlässig gearbeitet haben und in denen sie Gemeinsinn und Menschlichkeit zeigten. Ich traue ihnen zu, dass sie einen eigenen Weg zur Demokratie finden. Dazu brauchen sie niemanden, der ihnen sagt, wo es lang geht. Aber wenn man unterwegs ist, gibt es immer wieder Stellen, wo man überlegen muss, wie es weiter gehen kann. Da sind dann Partner gefragt, mit denen man gemeinsam überlegen kann.
Soweit meine Überlegungen zum Fehlversuch mit der Demokratie in Afghanistan. Im nächsten Rundbrief geht es dann um die Vermutungen zu einem von den Taliban dominierten Afghanistan.
Herzliche Grüße,
Peter Schwittek.
